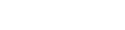Pressemitteilung vom 21. Juni 2024
Im Arbeitseinsatz für die Energiewende
HZDR-Wissenschaftler*innen bauen Forschung zu superkritischem Kohlenstoffdioxid aus
Ein besonderer Zustand des Kohlenstoffdioxids, das sogenannte superkritische CO2 (sCO2), könnte dank seiner speziellen Eigenschaften den Bau und Betrieb von Energietechnologien ermöglichen, die nachhaltig und umweltfreundlich Strom produzieren. An einer europaweit einzigartigen Anlage untersuchen Wissenschaftler*innen des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) im Verbundprojekt CARBOSOLA gemeinsam mit weiteren Partnern das Verhalten von sCO2. Dank einer Förderung des Sächsischen Wissenschaftsministeriums aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Höhe von 870.000 Euro können die Projektpartner die Großversuchsanlage nun um einen Wärmespeicher und eine Hochdruckverdichtungsstation und ergänzen. Das gibt ihnen die Möglichkeit, die Rolle von sCO2 in Energiespeichersystemen zu erforschen.
Pilotanlage eines neuartigen geologisch-elektrothermischen Energiespeichersystems auf Kohlenstoffdioxid-Basis. Sie soll nun um einen Wärmespeicher und eine Hochdruckverdichtungsstation ergänzt werden.
Bild: Sebastian Unger
„Superkritisches CO2 ist ein attraktives Arbeitsmedium für effiziente energie- und verfahrenstechnische Prozesse“, erklärt Dr. Sebastian Unger vom Institut für Fluiddynamik am HZDR, der das Ausbauprojekt leitet. „Im superkritischen Zustand ist das CO2 weder flüssig noch gasförmig, sondern es verbindet die vorteilhaften Eigenschaften beider Phasen. Dieser Zustand lässt sich beobachten, wenn CO2 über seinen kritischen Punkt hinaus erhitzt und komprimiert wird. Der kritische Punkt liegt bei einer Temperatur von etwa 31 Grad Celsius und einem Druck von rund 74 bar.“ Oberhalb dieser Werte gewinnt das CO2 einzigartige Eigenschaften. Vor allem die Tatsache, dass sich die Dichte durch Druck oder Temperaturanpassung variieren lässt, macht sCO2 für viele neue Anwendungen in der Energietechnik interessant.
Hoher Druck sorgt für hohe Temperaturen
Mit der neuen Hochdruckverdichtungsstation für Drücke bis 300 bar und einem angeschlossenen Wärmespeicher wollen die Forschenden vor allem die Nutzung von sCO2-Kreisläufen in Energiespeichersystemen weiter erkunden und optimieren. Bei der Verdichtung von sCO2 entsteht Wärme, je höher der Druck, desto höher die Temperatur. „Das so erhitzte Arbeitsmittel leiten wir in den Wärmespeicher, wo es die Wärme abgibt“, beschreibt Sebastian Unger den Prozess. „Wird dann noch das Medium zu niedrigerem Druck entspannt, sinkt die Temperatur des CO2 schlagartig Richtung null Grad Celsius, sodass es sich für Kühlungszwecke nutzen lässt. Anschließend fließt das Medium zurück in die Verdichtungsstation und alles beginnt von vorn.“
Damit kann der sCO2-Kreislauf Wärme und Kälte für industrielle Prozesse liefern. Doch das ist nicht alles. Superkritisches CO2 hat gute Aussichten auf eine tragende Rolle in der Energiewende. Wird der Verdichter mit überschüssigem Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben, dient eine derartige Anlage auch als Energiespeicher. Denn die thermische Energie lässt sich in einem umgekehrten Prozess mittels einer Turbine wieder in Strom umwandeln.
Aufbau der neuen Anlagenkomponenten
Der geplante Wärmespeicher wird im zukünftigen Experimentalbetrieb für die thermische Versorgung des Versuchsstandes verwendet. Auch der Speicher weist einige Besonderheiten auf. Kosteneffiziente und hochtemperaturfähige Speicherelemente werden aus dem massenhaft verfügbaren Material ALFERROCK® hergestellt, das in der Aluminiumindustrie als umweltbelastender Rotschlamm anfällt. Untersuchungen haben eine thermische Stabilität bis über 1000 Grad Celsius sowie damit verbundene hohe Energiedichten nachgewiesen. Aus diesem Grund ist ein hoher Speicherwirkungsgrad bei der Rückverstromung zu erwarten.
„Vor dem Bau der neuen Anlagenteile sind grundlegende Fragen zur Auslegung des gesamten Energiespeicherkreislaufs, der erforderlichen Peripherie und der Wärmeübertrager zur Ankopplung an die CARBOSOLA-Versuchsanlage zu klären“, sagt Sebastian Unger. Neben dem Leiter sind vier weitere Kollegen an dem Projekt beteiligt. In zwei Jahren will das Forschungsteam die ersten Experimente an der erweiterten Anlage starten.
Weitere Informationen:
Dr. Sebastian Unger I Institut für Fluiddynamik am HZDR
Tel. +49 351 260 3225 | E-Mail: s.unger@hzdr.de
Medienkontakt:
Simon Schmitt | Leitung und Pressesprecher
Abteilung Kommunikation und Medien am HZDR
Tel.: +49 351 260 3400 | E-Mail: s.schmitt@hzdr.de